Nie zuvor war die Digitalisierung ein so viel diskutiertes und dringliches Thema. Die Corona-Krise wirkt vor allem für Unternehmen wie ein Katapult für Digitalisierungsmaßnahmen. Selbst diejenigen, die sich hier bisher verwehrt haben, werden zu einer Auseinandersetzung gezwungen. Ganz im Zeichen von Homeoffice und virtueller Zusammenarbeit werden Abläufe und Arbeitsprozesse digitalisiert und neu strukturiert. Doch mit welchen Tools kann der Workflow optimiert und damit das Potenzial der Digitalisierung ausgeschöpft werden?
Die Grenzen von Excel
Für viele kleine und mittelständische Unternehmen lautet die ernüchternde Antwort hier oft: Microsoft Excel. Einer Umfrage des BARC-Instituts (Business Application Research Center) zufolge nutzen etwa 80 Prozent der befragten KMU Excel als Planungstool und für die Datenanalyse. Auch als CRM-Datenbank oder für Personaldaten kommt das Office-Programm weiterhin zum Einsatz. Doch seine weite Verbreitung ist nicht gleichzusetzen mit seiner Beliebtheit. Unzufriedenheit herrscht vor allem in Bezug auf die folgenden Aspekte:
- Mangelnde Flexibilität und Usability
- Dateninkonsistenz
- Fehlende Geschäftslogik
- Arbeitsintensiv durch manuelle Dateneingabe
- Für große Datenmengen ungeeignet
- Wenig Auswertungsmöglichkeiten, keine Simulation
Die Gründe für die Frustration mit Excel in Unternehmen lassen sich allerdings nicht allein auf sein Wesen zurückführen, sondern auch auf eine gesellschaftlichen Entwicklung: Im Zuge einer Individualisierung auf persönlicher und auf Unternehmensebene sowie einer wachsenden Spezialisierung entstehen immer mehr Nischen. Mit fortschreitenden technischen Möglichkeiten und Sehgewohnheiten steigen auch die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit von Produktivitätstools. Und nicht zuletzt fordert die Schnelllebigkeit einer digitalisierten Welt vor allem eines: Effizienz. Diesen modernen Ansprüchen gerecht zu werden war nie das gesetzte Ziel von One-Size-Fits-All-Lösungen wie Excel. Ein Grund mehr für Unternehmen, sich aus der Bequemlichkeit herauszubewegen und über eine individuelle Softwarelösung nachzudenken.
Dem individuellen Digitalisierungsbedarf mittelständischer Unternehmen lässt sich nicht mit Software von der Stange begegnen.
Maßgeschneiderte Softwarelösungen
Mit Standardsoftware verhält es sich ähnlich wie mit dem Henne-Ei-Problem: Sind zunächst die Arbeitsprozesse da, für die sich das passende Tool findet oder entstehen bestimmte Abläufe erst durch den Einsatz einer bestimmten Software? Häufig ist letzteres Szenario der Fall. Die Integration von Standardsoftware ist häufig aufwendig und kostspielig und sorgt nicht zuletzt für Frustration bei Mitarbeitenden, wenn sie ihre Arbeit den Tools anpassen müssen.
Der Einsatz von Individualsoftware bedeutet nicht nur eine Substitution der zuvor verwendeten Softwarelösung, sondern kann auch für eine Optimierung und Komprimierung des Arbeitsprozesses sorgen.
Mit Individualsoftware hingegen liegt der Fokus auf den unternehmenseigenen Bedürfnissen und Anforderungen, welche die Grundlage für die Softwareentwicklung bilden. So können Unternehmensprozesse bestehen bleiben – im besten Falle kann die Individualsoftware sogar nahtlos in bereits bestehende Lösungen integriert werden. Auf diese Weise arbeiten die eingesetzten Tools zu statt dagegen – die besten Voraussetzungen für eine Effizienzsteigerung.
EXTRA: Software für Unternehmer: Diese 5 dürfen dir nicht fehlen
Mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz
Eine Effizienzsteigerung ist jedoch nicht allein Sache der Software: Letztlich sind es die Mitarbeitenden eines Unternehmens, die für die Erledigung der Aufgaben zuständig sind. Und auch hier bedingen sich die Faktoren gegenseitig: Eine Individualsoftware, die von Anfang an die Bedürfnisse ihrer User abbildet, ist intuitiv und benötigt keine lange Einarbeitungszeit. Auch eine Umstellung bei Updates, die bei Standardlösungen häufig unfreiwillig installiert werden, fällt weg. Und eine gute User Experience resultiert schließlich ganz unbewusst in einer qualitativen und quantitativen Verbesserung der Leistung.
Langfristige Kostenersparnis
Für viele Unternehmen ist der Einsatz von Individualsoftware jedoch nicht eine Frage der Praktikabilität, sondern der Kosten. Auf den ersten Blick ist die individuelle Entwicklung natürlich die größere Investition, da die Konzeption und Programmierung zeit- und damit kostenintensiv sind. Auf lange Sicht besteht jedoch:
- eine Kostenersparnis, die sich durch die Optimierung der Arbeitsprozesse mit dem neuen Tool ergibt.
- eine Investitionssicherheit: Bei Zusammenarbeit mit einer Agentur wird der Quellcode der Software meist vollständig samt Dokumentation übergeben.
- Auch gibt es eine feste Ansprechperson bei Problemen oder Änderungswünschen und im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit können Programme fortwährend weiterentwickelt werden.
Im Gegensatz zu Lizenzkosten, ganz gleich ob zum Einmalpreis oder im Abonnement, ist die Entwicklung einer Individualsoftware also eine Investition in die Zukunft eines Unternehmens.
Unser Gratis-ePaper: Agile Führung
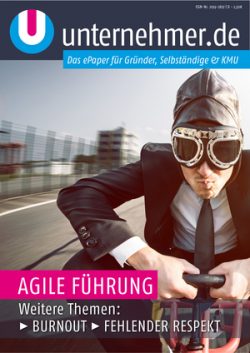 Unser ePaper mit den besten Tipps rund um das Thema Mitarbeiterführung:
Unser ePaper mit den besten Tipps rund um das Thema Mitarbeiterführung:
→ über 55.000 Abonnenten
→ jedes Quartal eine neue Ausgabe
→ als PDF bequem in dein Postfach









Der Kunde will aber einen Maßanzug zum Preis eines Anzugs von der Stange. Das funktioniert so nicht und man landet dann doch wieder beim billigeren Modell und nimmt Abstriche in Kauf. Selbst bei meinem Steckenpferd, den eingebetteten Systemen, wird bei Hard- und Software immer stärker auf Standardlösungen gesetzt. Das sah bis vor ein paar Jahren noch anders aus.